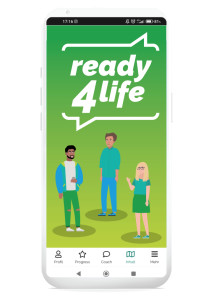Nehmen wir an, dass Sie Informationsmaterial zum Thema Sucht erstellen möchten, um Familienangehörigen einen Leitfaden zum Umgang mit einem suchtkranken Kind oder suchtkranken Eltern zu geben. Und Sie möchten, dass alle betroffenen Personen auf dieses Informationsmaterial zugreifen können. Allein die Idee, dass «das Projekt allen offensteht», garantiert nicht, dass alle betroffenen Personen die gleiche Möglichkeit haben, auf dieses Material zuzugreifen, wenn Sie nicht entsprechende Massnahmen vorsehen, um niemanden auszuschliessen.
Für einen durchdachten Ansatz der Chancengleichheit muss zunächst berücksichtigt werden, dass die Zielgruppe dieses Projekts sehr vielseitig ist, sowohl was den Bildungsgrad als auch was die Sprachkenntnisse angeht. Sie müssen daran denken, dass dieses Material für Personen, die einen geringeren Bildungsgrad haben, einfach verständlich sein muss. Ebenso gilt es, fremdsprachige Personen zu berücksichtigen, die eine der Landessprachen gar nicht oder nicht gut genug beherrschen. Auch sie müssen von diesem Material profitieren können. Dabei stellt sich die Frage nach der Übersetzung in mehrere Migrationssprachen.
Auch muss die Form (der Kanal) des Materials überlegt sein. Ist zum Beispiel eine Informationsbroschüre für die Bedürfnisse der benachteiligten Zielgruppe angemessen? Und garantieren die vorgesehenen Verbreitungswege, dass diese Zielgruppe auf die erstellten Informationsmaterialien zugreifen kann? Welche Kanäle werden von unterschiedlichen benachteiligten Gruppen am häufigsten genutzt? Bei unserer Beratung berücksichtigen wir die Realitäten und Anforderungen jedes Projekts und behandeln unterschiedliche Herausforderungen, um die Chancengleichheit zu erhöhen.